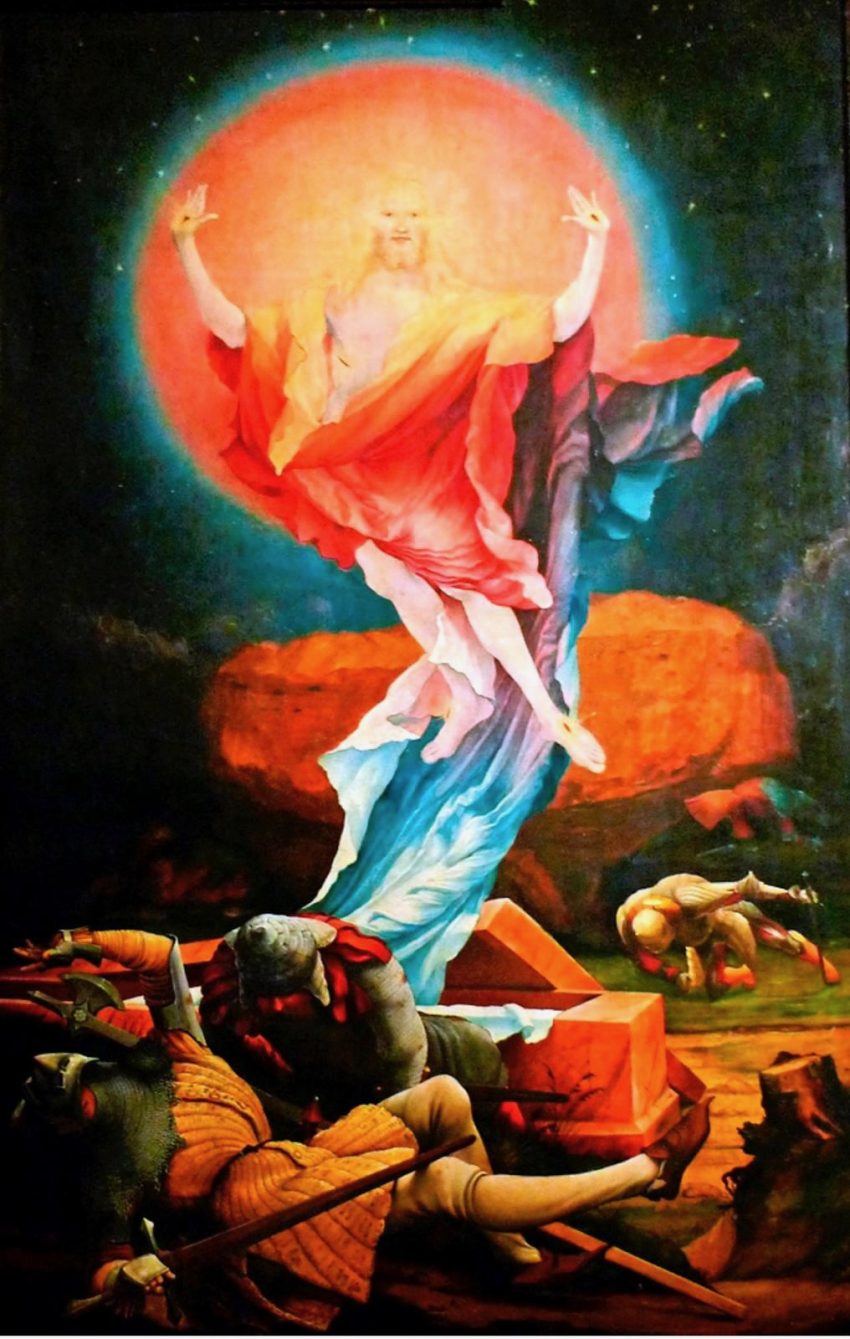Manchmal fällt uns Glaube ganz schwer, vor allem, wenn uns die Beweise fehlen. Der sog. „ungläubige Thomas“, von dem wir im heutigen Evangelium hören, tut sich auch schwer, die Botschaft der Auferstehung zu glauben. „Wenn ich nicht sehe, glaube ich nicht!“ entgegnet er den anderen Jüngern und trifft damit unsere Zeit auf den Punkt. Wir erleben hier zur Zeit einen massiven Umbruch. Galt vor wenigen Jahren noch die Naturwissenschaft als unumstößlich, so sprechen heute viele Menschen von alternativen Wirklichkeiten und meinen damit Fake News und andere Halbwahrheiten oder gar Verschwörungstheorien.
Ich möchte mich heute daher auf die Suche nach Wahrheit machen und der Frage nachgehen, was eigentlich Wahrheit bedeutet. Vielleicht ergibt sich daraus ja auch eine neue Bedeutung für unsere Thomasgeschichte.
Religiöses Paradigma
Jahrhundertelang definierte die Religion und damit die Kirche, was wahr ist. Wahr ist demnach, was der Lehre der Kirche entspricht. Die Theologie und Philosophie dienen dazu, den Wahrheitsanspruch der Religion und der Kirche abzusichern. Der einzelne Mensch lebt in dieser „Wahrheitsblase“ seiner Kultur. Diese Blase bietet Sicherheit und Orientierung. Sie hilft auch mit den Herausforderungen der Welt umzugehen und gibt Antworten aus der jeweiligen Geschichte (Tradition).
Philosophisches Paradigma
Auch wenn mit dem ausgehenden Mittelalter die ersten Naturwissenschaften aufkommen, gibt immer noch die Philosophie den Ton an, wenn es um die Suche nach Wahrheit geht. Doch emanzipiert sich die Philosophie zunehmend von der Theologie und damit der Kirche. Der Einfluss der Religion geht zurück. Durch die Reformation in Westeuropa und die damit aufkommenden Glaubenskriege wird klar, dass Religion und Kirche keine Garanten für Wahrheit sein können. Die Philosophie nimmt immer mehr diesen Platz ein. Mit der Aufklärung versucht die Philosophie die Fesseln der Theologie abzulegen und eine eigene Wissenschaft zu werden. Immanuel Kant versucht die wichtigsten Regeln für das Zusammenleben ohne Gott zu begründen. Mit dem kategorischen Imperativ gelingt ihm eine Grundregel menschlichen Handelns, die keinen Gottesbezug kennt und trotzdem eine hohe ethische Norm enthält.
Wenn ich nicht sehe, glaube ich nicht!
Mit dem Anspruch, das nicht-Messbare messbar zu machen, tritt die Naturwissenschaft ihren Siegeszug um die Welt an. Sie wird zum Maßstab für Wahrheit schlechthin. In der Naturwissenschaft gilt nur noch als wahr, was berechenbar und reproduzierbar ist. Vor allem in der Abkehr von der Religion wird die Naturwissenschaft als Erleuchtung gesehen. Alles, was wir nicht mit unseren Sinnesorganen wahrnehmen können, existiert für die Naturwissenschaft nicht. Manchmal müssen wir unseren Sinnesorganen durch den Einsatz entsprechender Technik (z.B.: Mikroskop) etwas auf die Sprünge helfen, aber Wahrheit muss wahrnehmbar sein.
Thomas wird daher immer wieder als der Skeptiker unter den Jünger:innen bezeichnet. Doch werden wir seiner Forderung „Wenn ich nicht sehe, glaube ich nicht!“ tatsächlich gerecht, wenn wir ihn als Vorläufer moderner Naturwissenschaft betrachten.
Wahrheit liegt im Auge des Betrachters
Die Katastrophe des Zweiten Weltkrieges hat in der Philosophie des 20. Jahrhunderts eine enorme Schockwelle ausgelöst. Gerade in der französischen Philosophie wurde im Anschluss an die Shoa an einer transzendenten Wahrheit gezweifelt. Wahrheit kann – wenn es überhaupt so etwas gibt – nur im Auge des Betrachters liegen und ist daher von Person zu Person unterschiedlich. Im Dialog nähern wir uns nun nicht mehr einer Wahrheit an, sondern tauschen unsere Wahrheiten aus. Die Erfahrung der Shoa und der Vernichtung des Weltkrieges machte die Existenz einer Wahrheit (im metaphysischen Sinn) undenkbar. Die Philosophie der Aufklärung war in dieser Katastrophe gescheitert.
Die Katastrophe von Tschernobyl (1986) hatte schließlich zur Folge, dass das Vertrauen in die Technik und damit in die Naturwissenschaft ebenso erodierte. Auch wenn diese Auswirkungen noch nicht sofort in der breiten Bevölkerung angekommen waren, so veränderten sie doch den Zugang in der Bevölkerung zum Wahrheitsbegriff.
Plötzlich wurde alles in Frage gestellt. Es gab nichts mehr, an dem man sich festhalten könnte. Alternative Wahrheiten standen plötzlich dem Mainstream gleichwertig gegenüber. Gerade die Pandemie zeigte, welch enorme Auswirkungen diese Verschiebungen auf die breite Bevölkerung haben. Wenn ich grundsätzlich alles anzweifle, dann ist alles richtig und falsch, wahr und unwahr zugleich. Es wird unmöglich, etwas als gesichert zu erkennen und sich selbst eine Meinung zu bilden, die auf Tatsachen beruht.
Wenn ich nicht sehe, glaube ich nicht!
Doch lässt sich diese Aussage des Thomas auch anders interpretieren und lesen. „Wenn ich nicht sehe“, kann auch heißen, „wenn ich keine Beziehung habe“. Thomas war bei der ersten Erscheinung nicht dabei, er ist daher dem Auferstandenen noch nicht begegnet und hat daher auch noch keine Beziehung zu ihm. „Wenn ich nicht sehe, glaube ich nicht!“ wird hier zu einer Bitte um Beziehung. Thomas fordert eine Beziehung zu diesem Jesus, damit er glauben kann.
Mit dem Blick auf die heutige Gesellschaft scheint mir das durchaus ähnlich zu sein. Wir scheinen verschiedene gesellschaftliche „Blasen“ (bubbles) zu haben, die jede ihre eigene Wahrheit und ihre eigene Interpretation der Welt besitzt. Damit wir heute Wahrheit als solche erkennen können, braucht es Beziehungen zu den Menschen.
Glaube im religiösen Sinn hat also immer schon mit Beziehungen zu tun. Es geht um die Beziehung zu Gott genauso, wie die Beziehung zu unseren Mitmenschen. In diesen Beziehungen und Begegnungen erleben wir Glaube und Wahrheit.